Partnerschaftskonferenz
Historische Vergleiche und Unterschiede

Die erste Partnerschaftskonferenz in Crailsheim war abwechslungsreich. Ein gefeiertes Konzert der Stadtkapelle im Hangar, ein „Markt der Partnerstädte“ und viele persönliche Gespräche. Auch die Geschichte war Thema beim Kongress im Ratssaal – und brachte Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zum Vorschein. Zur Feier des 25. Bestehens der Partnerschaften zwischen Crailsheim und Biłgoraj sowie Crailsheim und Jurbarkas blickten Vertreter auf die jeweiligen Geschichten zurück. Die Vorträge wurden teils mit Bildern der Vergangenheit gehalten, die die eindrücklichen Erzählungen der Historiker noch vertieften. Klar wurde jeweils: Die Vergangenheit ist wichtig, um Gegenwart und Zukunft anders zu gestalten.
Als Crailsheim in Flammen stand
„Eine glückseelige Stadt ist Crailsheim“ – mit diesem Zitat aus der Heelschen Chronik begann Dr. Helga Steiger vom Stadtarchiv Crailsheim ihren historischen Vortrag zur Städtepartnerschaftskonferenz am 29. März 2025. Über Jahrhunderte war Crailsheim immer wieder von Krieg betroffen, blieb aber weitgehend verschont. Das änderte sich dramatisch im April 1945.
Steiger zeichnete die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs in Crailsheim minutiös nach. Der „totale Krieg“ hatte mit dem Führererlass vom 25. Juli 1944 auch das Hohenloher Städtchen erreicht – zunächst indirekt, durch steigende Opferzahlen und die Einrichtung eines Lazaretts. Am 12. November 1944 wurde der Volkssturm vereidigt, bestehend aus Jugendlichen und alten Männern. Kreisleiter Otto Hänle verband in seiner Rede diesen Akt mit den „Blutzeugen der Bewegung“ – eine Verherrlichung, die rückblickend besonders bitter wirkt.
Bombenregen und weiße Fahnen
Ab Februar 1945 wurde Crailsheim zum Ziel alliierter Luftangriffe. Am 2. Februar starben 13 Menschen beim ersten Bombenangriff. Der 23. Februar brachte mit 928 abgeworfenen Bomben massive Zerstörungen am Bahnhof und in Industrieanlagen, darunter das Gaswerk und die Robert-Bosch-Werke. Etwa 70 Menschen kamen ums Leben.
Tragische Einzelschicksale blieben nicht aus: Der Hitlerjunge Kurt Marquart verblutete auf dem Rathausturm, nachdem ihm eine Detonation den Helm vom Kopf gerissen hatte. Ein besonders schwerer Schlag traf die Stadt am 4. April: In einem Bunker starben 20 Wehrmachtshelferinnen und mehrere Feuerwehrmänner.
Am 6. April zogen amerikanische Panzerverbände in Crailsheim ein – kampflos, da ein mutiger Bürger mit weißer Fahne entgegengegangen war. Doch ein Befehl Heinrich Himmlers vom 7. April drohte allen, die weiße Fahnen zeigten, mit der Erschießung. „In einem Haus, in dem die weiße Fahne gezeigt werde, sollten alle männlichen Personen ab 16 Jahren erschossen werden“, zitierte Steiger.
Rückeroberung, Rückzug, Rache
Die SS und Wehrmachtstruppen aus Ellwangen nahmen die Stadt unter Artilleriebeschuss. Die Amerikaner zogen sich am 10. April aus Munitionsmangel zurück, legten jedoch an mehreren Stellen Feuer. Der deutsche „Rückeroberung“ folgten neue Angriffe amerikanischer Jagdbomber.
Trotz aussichtsloser Lage ließ Kreisleiter Hänle ab dem 14. April neue Panzersperren errichten. Die SS sprengte am 20. April, Hitlers Geburtstag, die Jagstbrücke. Das heranrückende US-Infanterieregiment betrachtete das als Feindhandlung. In der Nacht zum 21. April ging Crailsheim in einem Feuersturm unter.
„Die Brände sind gefährlicher als der Feind“, zitierten die Amerikaner später aus ihren Einsatzberichten. 95 Prozent der Innenstadt lagen in Trümmern, die ursprünglichen Gebäude waren kaum mehr zu erkennen.
Kein Widerstand – aber auch keine Rettung
Warum konnte die Stadt nicht gerettet werden? Steiger nannte fehlende mutige Initiativen zur Kapitulation. Bürgermeister Friedrich Fröhlich war bereits geflohen, Hänle und SS-Hauptsturmführer Hübner hielten an ihrer linientreuen Haltung fest. „Die Situation zur Rettung der Stadt konnte nicht herbeigeführt werden“, sagte Steiger. In amerikanischen Zeitungen erschien Crailsheim später als „bloody German bastion“.
In den letzten Kriegstagen starben in Crailsheim rund 300 Menschen: Zivilisten, Soldaten beider Seiten und zwangsverpflichtete Arbeitskräfte aus Osteuropa. 167 Menschen wurden unter Lebensgefahr auf dem Alten Friedhof beigesetzt, meist anonym. Obwohl der Krieg zu Ende war, empfanden die Crailsheimer die Amerikaner nicht als Befreier. „Sie hatten Familienmitglieder und im Falle der meisten Crailsheimer ihren gesamten Besitz verloren“, erklärte Steiger. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im NS-Regime blieb aus Selbstschutz oft aus.
Wiederaufbau und neue Beziehungen
Drei Elemente nannte Steiger als zentral für die Verarbeitung des Kriegstraumas: den Wiederaufbau, die internationale Verständigung und das Gedenken.
Schon ab Januar 1946 begann die Planung einer modernen Stadt mit breiteren Straßen und größeren Plätzen. In den 1950er Jahren entstanden neue Verwaltungsgebäude, das Rathaus wurde 1954 eingeweiht. 1979 wurde die Spitze des Rathausturmes als symbolisches Ende der Kriegszeit wieder aufgesetzt.
Die Städtepartnerschaft mit Worthington (USA), initiiert 1947 von Theodora Cashel, markierte den Beginn internationaler Annäherung. „Diese Städtepartnerschaft ist die erste transatlantische“, so Steiger. Sie wurde zum Vorbild für weitere Partnerschaften.
Auch das Gedenken hatte seinen Platz: Auf dem Alten Friedhof entstand ein Ehrenfriedhof, 1957 wurden viele anonym Bestattete identifiziert. 1959 wurde eine zweite Ehrenanlage auf dem Neuen Friedhof eingeweiht. Die Worte eines Vertreters des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind laut Steiger bis heute Mahnung und Verpflichtung zugleich: „In Crailsheim weiß man, was Krieg bedeutet.“
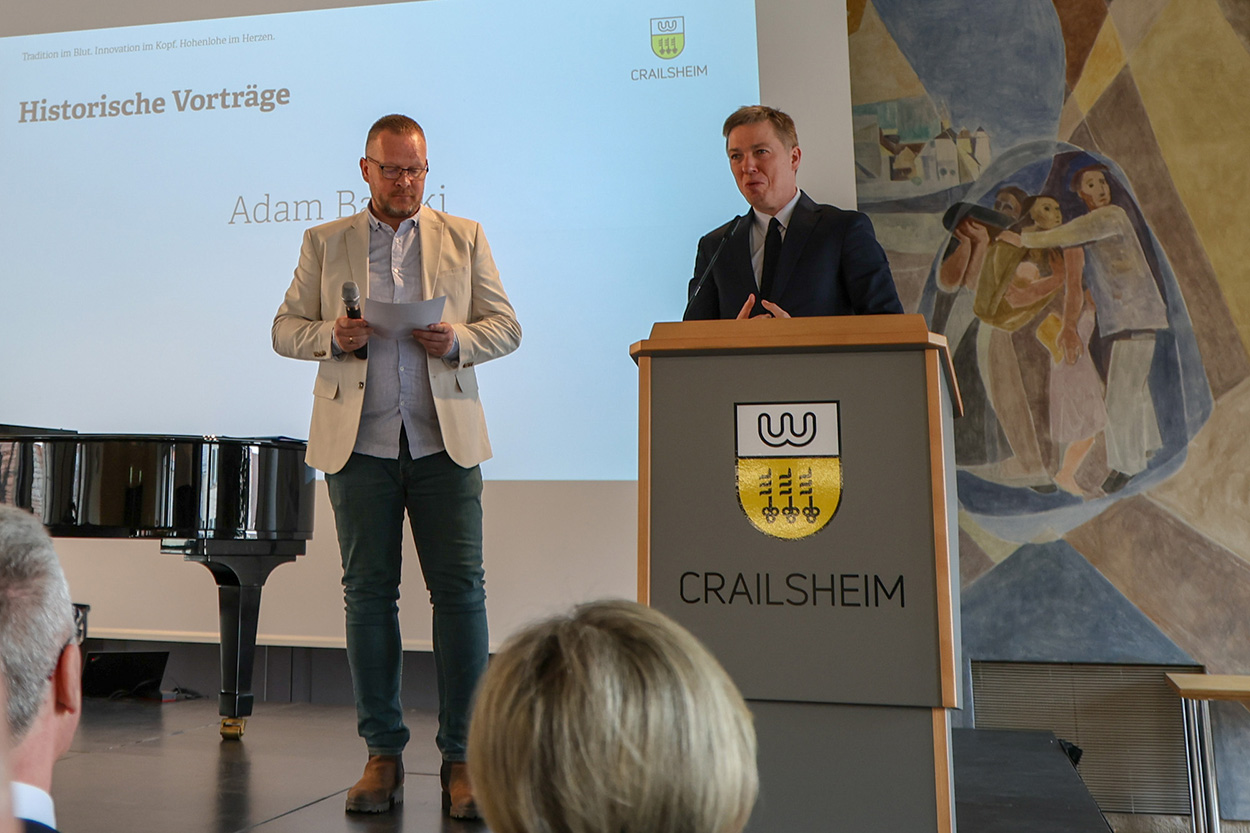
Biłgoraj im Schatten des Krieges
Der Vortrag von Historiker Adam Balicki wurde übersetzt, was dessen lebendiger Erzählweise keinen Abbruch tat.
Der Zweite Weltkrieg begann für die ostpolnische Stadt Biłgoraj am 8. September 1939 mit dem ersten Bombenangriff der deutschen Luftwaffe. Nur wenige Tage später folgte ein zweiter Angriff, am 14. September, bevor es am 16. September zur Schlacht um Biłgoraj kam. Hier kämpften Einheiten der polnischen Armee „Krakau“, 78 Soldaten verloren ihr Leben.
Am 17. September 1939 besetzten deutsche Truppen die Stadt. Kurzzeitig, vom 28. September bis 3. Oktober, rückten sowjetische Soldaten ein, ehe die Deutschen wieder die Kontrolle übernahmen. Bereits am 9. Oktober kam es zu einem Gegenangriff durch eine polnische Kavallerieeinheit unter Oberstleutnant Leon Koc, doch ohne nachhaltigen Erfolg.
Biłgoraj wurde in der Folge zum Sitz eines Landkreises im Distrikt Lublin unter deutscher Besatzung. Lebensmittelrationierungen, Verarmung und systematische Repression bestimmten den Alltag. Besonders schwer traf es die jüdische Bevölkerung, die schon bald unter der gesamten Härte der nationalsozialistischen Verfolgung litt.
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung
Adam Balicki schilderte eindrücklich die systematische Diskriminierung: „Die Juden mussten eine Armbinde mit dem blauen Davidstern tragen, ihre Geschäfte kennzeichnen und durften die Hauptstraße nicht betreten.“ Kinder jüdischer Familien wurden vom Schulbesuch ausgeschlossen, religiöse Bräuche verboten. Die Repression gipfelte in der sogenannten „Liquidation“: Am 2. November 1942 wurden 400 Menschen ermordet, rund 2.500 weitere ins Vernichtungslager Bełżec deportiert.
Auch das sogenannte „kleine Ghetto“ in der 3.-Mai-Straße wurde am 15. Januar 1943 endgültig aufgelöst. Nach Balickis Einschätzung fielen rund 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung Biłgorajs dem Holocaust zum Opfer.
Verhaftungen, Deportationen – und Widerstand
Doch nicht nur Juden waren von Verfolgung betroffen. Im Rahmen der AB-Aktion wurden auch viele polnische Bürger verhaftet. Balicki nennt vier große Verhaftungswellen: Oktober 1939, Juni 1940, März 1941 und Mai 1942. Die meisten Häftlinge wurden in Konzentrationslager deportiert.
Trotz der Repressionen entwickelte sich früh eine aktive Widerstandsbewegung. Bereits im Oktober 1939 entstand die erste Zelle des „Dienstes für den Sieg Polens“, später umbenannt in „Heimatarmee“. Dank der Lage zwischen dem Solska- und Janów-Wald wurde Biłgoraj zu einem bedeutenden Stützpunkt. Die Region erhielt den Decknamen „Akademia“, ihr Befehlshaber war Leutnant Józef Stegliński, Codename „Cord“.
1943 formierte sich unter seinem Kommando eine Partisaneneinheit. Viele ihrer Mitglieder kamen in der Schlacht bei Osuchy ums Leben. Am 24. Juli 1944 befreiten sowjetische Truppen gemeinsam mit Partisanen die Stadt.
Vom Wiederaufbau zur kulturellen Blüte
Nach Kriegsende spielte Józef Dechnik eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau. Die Bevölkerung stieg rasch an: Ende 1965 lebten rund 10.000 Menschen in Biłgoraj, 1978 waren es bereits über 18.000. In dieser Zeit entstanden wichtige Industriebetriebe wie das Metallwerk „Bilmet“ oder die Textilfabrik „Mewa“. Auch im Bildungs- und Kulturbereich wurde investiert – mit der Gründung des Bilgorajer Kulturzentrums (BCK) im Jahr 1953 wurde ein kultureller Meilenstein gesetzt.
Einen tiefgreifenden Einschnitt bedeutete die Verwaltungsreform 1975, durch die Biłgoraj den Status als Kreisstadt verlor. Doch die Stadt erhielt 1978 das Kommandeurskreuz des Ordens Polonia Restituta – eine symbolische Anerkennung für ihre Entwicklung und Widerstandsgeschichte.
Protest und Wandel
Auch in den 1980er Jahren war Biłgoraj ein Ort politischer Bewegung. Während der Auguststreiks 1980 war „Mewa“ die erste Fabrik, die ihre Arbeit niederlegte. Weitere Betriebe folgten, erste Komitees der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność wurden gegründet. Während des Kriegsrechts kam es zu Protestaktionen, Flugblattverteilungen und Streiks. Einige Aktivisten wurden von der Staatsmacht interniert.
Nach dem Umbruch 1989 begann für Biłgoraj eine neue Ära. Balicki betont die wirtschaftliche Erneuerung: „Ein Symbol für die wirtschaftlichen Veränderungen war die Gründung der Firma Ambra im Jahr 1990.“ Weitere bedeutende Unternehmen wie Black Red White und PolSkone siedelten sich an. Die Verwaltungsreform von 1999 stellte Biłgoraj wieder als Kreisstadt auf.
Freundschaft über Grenzen hinweg
Ein zentrales Thema in Balickis Vortrag war die internationale Zusammenarbeit in der Gegenwart. Die Städtepartnerschaft mit Crailsheim, geschlossen am 16. September 2000, ist für ihn ein bedeutendes Kapitel: „Der Austausch von Künstlergruppen, die Förderung der lokalen Kultur und die Präsentation unserer Geschichte sind zentrale Inhalte der Partnerschaft.“ Seit 2000 sind Manfred Salinger und der frühere Crailsheimer Oberbürgermeister Andreas Raab, der mittlerweile gestorben ist, Ehrenbürger von Biłgoraj – Ausdruck einer lebendigen und fruchtbaren Verbindung.
Auch Dainora Saulėnienė, Dolmetscherin aus der litauischen Partnerstadt Jurbarkas, gab in ihrem Vortrag einen eindrucksvollen Einblick in die wechselvolle Geschichte ihrer Heimatstadt – von der ersten Erwähnung im Jahr 1259 bis zu den aktuellen Entwicklungsprojekten im 21. Jahrhundert.

Frühzeit und kulturelle Blüte
„1611 verlieh der polnische König Sigismund III. Jurbarkas die Rechte von Magdeburg und ein Wappen mit drei weißen Lilien“, erklärte Saulėnienė. Nach der Unabhängigkeit Litauens 1918 blühte die Stadt auf: Wirtschaft, Bildung und Kultur entwickelten sich rasant.
Ein düsteres Kapitel begann 1940 mit der sowjetischen Besatzung, gefolgt vom Einmarsch der Wehrmacht am 22. Juni 1941. Innerhalb weniger Monate wurde nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung der Stadt ermordet – rund ein Drittel der Einwohner. „Eine der schönsten jüdischen Holzsynagogen Europas, erbaut 1790, wurde verbrannt“, berichtete Saulėnienė.
Widerstand gegen die sowjetische Okkupation
Mit der Rückkehr der sowjetischen Truppen 1944 formierte sich ein breiter Widerstand. Etwa 30.000 Männer suchten Zuflucht in den Wäldern, viele davon schlossen sich den Partisanen – den sogenannten Waldbrüdern – an. „Die Mehrheit wählte bewusst den Weg des bewaffneten Kampfes gegen die sowjetische Herrschaft und Russifizierung“, so Saulėnienė. Einer der Anführer, Partisanengeneral Jonas Žemaitis, hielt sein geheimes Hauptquartier bis 1953 im Šimkaičiai-Wald. Er wurde 1954 in Moskau hingerichtet.
Kollektivierung, Deportation, Repression
Die sowjetische Besatzung brachte Zwangskollektivierung und Massendeportationen mit sich. Bauern wurden enteignet, viele Familien – selbst mit Schwangeren und Säuglingen – nach Sibirien verschleppt. „Die meisten von ihnen starben beim Transport in Viehwaggons“, sagte Saulėnienė und zeigte ein Foto litauischer Kinder im Exil, die von den Sowjets als Feinde betrachtet wurden.
Während der Sowjetherrschaft wurde Jurbarkas wiederaufgebaut und industrialisiert. Heute ist die Selbstverwaltungsgemeinde Jurbarkas 1.507 Quadratkilometer groß, etwa 35 Prozent davon sind Wald.
Mit der Unabhängigkeit Litauens am 11. März 1990 begann eine neue Zeit. Der brutale Versuch der sowjetischen Armee, das Land am 13. Januar 1991 zurückzuerobern, kostete 14 Menschen das Leben. Doch „die Freiheit wurde verteidigt“, betonte Saulėnienė.
Seit dem EU-Beitritt Litauens 2004 habe sich viel verändert. Heute leben rund 27.000 Menschen in der Gemeinde. Viele sind in modernen Betrieben tätig – etwa im Logistikunternehmen MANVESTA LOGISTIC oder in der Schweinezucht Dainiai mit 35.000 Tieren.
Zukunftsprojekte für eine nachhaltige Region
Die Stadt investiert gezielt in nachhaltige Infrastruktur. Es gibt ein gemeinsames elektronisches Ticketsystem mit Nachbargemeinden, elektrische Busse und einen neuen Busbahnhof. Ein ehrgeiziges Projekt ist der Bau eines Flusshafens am Nemunas, mit geplanter Inbetriebnahme im Sommer 2026. „Der Hafen soll den Gütertransport zum Seehafen Klaipėda ermöglichen“, so Saulėnienė weiter.
Auch kulturell ist die Stadt aktiv: „In 26 Gruppen des Kulturhauses tanzen, spielen und singen über 500 Jurbarkasser, viele davon haben auch in Crailsheim aufgetreten“.
Internationale gelebte Freundschaften
Jurbarkas pflegt enge Partnerschaften mit Städten in Belgien, Polen und Deutschland: Laakdal, Ryn, Hajnowka, Lichtenberg – und besonders Crailsheim, mit dem 2000 ein offizielles Abkommen unterzeichnet wurde. Auch Prof. Dr. Wolfgang von Stetten, ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Künzelsau und in Jurbarkas Ehrenbürger seit 2015, ist als Generalkonsul Litauens eng mit der Region verbunden.
Zum Abschluss betonte Dainora Saulėnienė die Bedeutung dieser Beziehungen: „Die langjährigen Partnerschaftsbeziehungen zwischen Jurbarkas, Crailsheim und dem Berliner Bezirk Lichtenberg basieren auf Vertrauen, Offenheit und gemeinsamen Werten.“ In einer Welt voller Unsicherheit seien diese Verbindungen mehr als nur freundschaftlich – sie seien ein Zeichen gelebter europäischer Gemeinschaft.
„Unsere Freundschaft erinnert uns daran, dass wir nur durch Zusammenarbeit Frieden und Sicherheit schaffen können“, sagte sie. Und sie fügte hinzu: „Die Kontinuität ist uns Ansporn für die Stärkung der Gemeinschaft und den Aufbau eines sicheren und geeinten Europas.“
Vergleiche im Podiumsgespräch
Zum Abschluss der Konferenz im Ratssaal ließen die drei Vortragenden, moderiert von Dennis Arendt die Vergangenheit Revue passieren und blickten auch auf die Zukunft.
Alle drei Städte – Crailsheim, Biłgoraj und Jurbarkas – wurden im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört. Dabei waren ihre Erfahrungen mit dem Krieg durchaus unterschiedlich. „Crailsheim hatte bis kurz vor Kriegsende kaum direkte Berührung mit Kampfhandlungen“, erläuterte Dr. Helga Steiger vom Stadtarchiv Crailsheim. „Im Gegensatz dazu war Biłgoraj deutlich länger vom Krieg und der Besatzung betroffen.“
In Crailsheim begannen Wiederaufbau und Auseinandersetzung mit der NS-Zeit relativ bald nach Kriegsende. Anders war das in den beiden Partnerstädten im Osten Europas: „Bei uns begann das erst ab etwa 1990“, erklärte Skirmantas Mockevičius, Bürgermeister von Jurbarkas. Die kommunistische Herrschaft unter sowjetischer Besatzung habe eine offene Aufarbeitung lange verhindert. Heute jedoch erinnern auch Biłgoraj und Jurbarkas an ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die während der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden.
In allen drei Städten fiel auch die jeweilige Synagoge der Zerstörung zum Opfer – in Biłgoraj und Jurbarkas durch die Nationalsozialisten, in Crailsheim erst beim alliierten Luftangriff. „Die Bebauung war damals sehr eng“, erklärte Helga Steiger. „Deshalb war es den Nationalsozialisten zu riskant, die Synagoge selbst niederzubrennen – geschändet wurde sie leider trotzdem.“
Auch aktuelle Ereignisse stärken die Verbindung zwischen den Partnerstädten. Dennis Arendt erinnerte an die Hilfsaktionen aus Biłgoraj für die Ukraine – das Nachbarland liegt nur wenige Kilometer entfernt. Gerade in solchen Momenten werde die Bedeutung von persönlichen Kontakten greifbar. „Es reicht nicht, sich nur auf Schlagzeilen oder die tägliche Nachrichtenflut zu verlassen“, sagte Steiger. „Der direkte Austausch ist entscheidend.“
Der gemeinsame Blick in die Zukunft war von dem Wunsch getragen, die Partnerschaften weiter zu festigen – über viele weitere Jahre hinweg. „Damit wir in 25 Jahren zum 50. Jubiläum sagen können: Es hat funktioniert“, so Adam Balicki, Historiker aus Biłgoraj. Und Helga Steiger fügte hinzu: „Durch solche Städtepartnerschaften wächst ein Netz der Solidarität. Daran sollten wir immer weiterweben.“
Die Erste Städtekonferenz in Crailsheim hat gezeigt, die Freundschaften sind stark und wachsen weiter – aufgrund gemeinsamer Vergangenheit, unterschiedlicher Erlebnisse, aber vor allem wegen dem persönlichen Kontakt. Freundschaften sind über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und zeigen, gemeinsame Unterschiede machen die Zukunft bunter.
